.
# #
###
##Erste Satzung zur Änderung der Satzung der
#
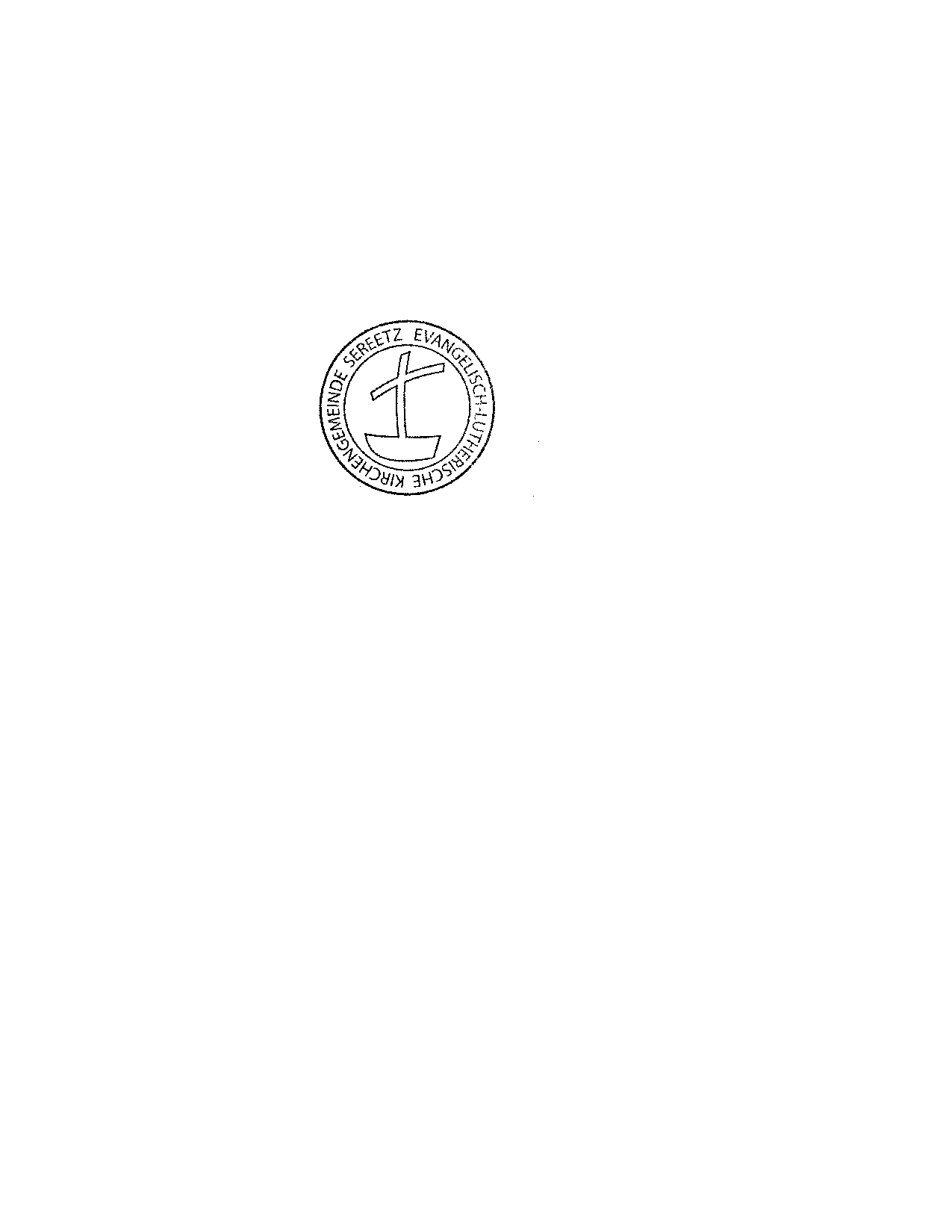
§ 1
#§ 2
§ 1
#§ 2
§ 1
#§ 2
Artikel 1
Artikel 2
Ausgabe 2 Teil AKiel, 28. Februar 2025
I. Entscheidungen der Landessynode, Kirchengesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften
Nr. 11Verwaltungsvorschrift
für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(Allgemeine Dienstordnung)
für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(Allgemeine Dienstordnung)
Vom 7. Februar 2025
1 Das Landeskirchenamt hat aufgrund von § 13 Absatz 5 des Kirchengesetzes über den kirchenmusikalischen Dienst (KMusG) vom 9. März 2017 (KABl. S. 211), das durch Artikel 2 des Kirchengesetzes vom 29. November 2022 (KABl. S. 531, 533) geändert worden ist, die folgende Verwaltungsvorschrift erlassen:
####1. Geltungsbereich
1 Diese Verwaltungsvorschrift regelt Rechte und Pflichten aus dem Anstellungsverhältnis für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker und deren Dienstgeber. 2 Sie gilt als allgemeine Dienstanweisung für den Dienst der hauptberuflichen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sowie für nebenberufliche Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker entsprechend.
#2. Allgemeine Bestimmungen
#2.1
Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker ist in ihrem bzw. seinem Dienst nach § 13 Absatz 2 KMusG mitverantwortlich für den Aufbau und das Leben der Gemeinde.
#2.2
Der Dienst findet in Zusammenarbeit mit allen statt, die in der Gemeinde ihren Dienst tun.
#2.3
1 Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker untersteht der Dienstaufsicht des Dienstgebers. 2 Der Dienstgeber kann die Dienstaufsicht delegieren.
#2.4
1 Die kirchenmusikalische Fachberatung der Kirchenmusikerin bzw. des Kirchenmusikers erolgt durch die Kreiskantorin bzw. den Kreiskantor. 2 Die kirchenmusikalische Fachberatung ist Teil der Aufsicht über die kirchlichen Körperschaften in Angelegenheiten der Kirchenmusik.
#2.5
Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker ist bei Beratungen, die ihren bzw. seinen Aufgabenbereich betreffen, hinzuzuziehen.
#2.6
1 Die Kantorin bzw. der Kantor (§ 12 Absatz 1 KMusG) soll an den Dienstbesprechungen der Mitarbeitenden ihrer bzw. seiner Dienststelle teilnehmen. 2 Andere Kirchenmusikerinnen bzw. Kirchenmusiker sind berechtigt, an den Dienstbesprechungen der Mitarbeitenden ihrer Dienststelle teilzunehmen.
#3. Gottesdienst und Kasualien
#3.1
1 Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker hat das Recht und die Pflicht zur Ausübung ihres bzw. seines Dienstes bei allen Gottesdiensten und Kasualien der Gemeinde im Rahmen ihres bzw. seines Dienstumfangs (§ 13 Absatz 4 Satz 1 KMusG). 2 Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker ist für die liturgische Eignung und künstlerische Qualität der Kirchenmusik verantwortlich.
#3.2
1 Die Gestaltung des Gottesdienstes einschließlich der Liedauswahl ist rechtzeitig, in der Regel mindestens drei Tage vorher, einvernehmlich zwischen den Personen im Verkündigungsdienst, die den Gottesdienst gestalten, abzustimmen. 2 Gottesdienste mit besonderer musikalischer Ausgestaltung sind langfristig gemeinsam zu planen. 3 Ist im Einzelfall das Einvernehmen nicht zu erzielen, entscheidet die den Gottesdienst leitende Person. 4 Kommt es wiederholt zu keinem Einvernehmen, ist die Angelegenheit durch die zuständige Pröpstin bzw. den zuständigen Propst unter Einbeziehung der beteiligten Personen sowie der Fachberatung zu klären und zu entscheiden.
#3.3
Grundlage des kirchenmusikalischen Dienstes sind die landeskirchlich eingeführten Gottesdienstordnungen und Gesangbücher.
#3.4
Jede musikalische Mitwirkung im Gottesdienst und bei Kasualien darf nur im Einvernehmen mit der Kirchenmusikerin bzw. dem Kirchenmusiker erfolgen.
#4. Leitung von Chor- und Instrumentalgruppen
#4.1
1 Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker sorgt für die musikalische Gestaltung der Gottesdienste, fördert den Gemeindegesang, leitet Chor- und Instrumentalgruppen, pflegt das Orgelspiel und vermittelt in kirchenmusikalischen Veranstaltungen geistliche Inhalte. 2 Sie bzw. er weckt und fördert die musikalischen Gaben und Kräfte in der Gemeinde.
#4.2
1 In regelmäßigen, vielfältigen, gottesdienstlichen und konzertanten Angeboten wird der Auftrag der Kirchenmusikerin bzw. des Kirchenmusikers zur Verkündigung und zur Pflege der Musikkultur wahrgenommen. 2 Hierbei werden nach Möglichkeit die gemeindeeigenen Chor- und Instrumentalgruppen eingesetzt. 3 Die Auswahl der aufzuführenden Werke trifft die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker.
#4.3
1 Soweit Chor- und Instrumentalgruppen sowie andere gemeindliche musikalische Gruppen in der Gemeinde bisher nicht existieren, gehört es zu den Aufgaben der Kirchenmusikerin bzw. des Kirchenmusikers deren Gründung anzustreben. 2 Zu den Aufgaben der Kirchenmusikerin bzw. des Kirchenmusikers gehört auch die Förderung von vorhandenen Chor- und Instrumentalgruppen. 3 Diese können beispielsweise durch Arbeitstagungen, Probenwochenenden, Freizeiten und Geselligkeiten gefördert werden. 4 Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker soll Chor- und Instrumentalgruppen an gottesdienstliche, nach Möglichkeit auch an konzertante Aufgaben, heranführen. 5 Steht ein Chor oder eine Instrumentalgruppe unter der Leitung der Kirchenmusikerin bzw. des Kirchenmusikers, so entscheidet sie bzw. er nach fachlichen Kriterien über die Teilnahme.
#4.4
Bei der Terminierung von Dienstverpflichtungen sind festgelegte regelmäßige Probenzeiten für Chor- und Instrumentalgruppen zu berücksichtigen.
#4.5
Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker strebt die Zusammenarbeit mit Chor- und Instrumentalgruppen, die nicht unter ihrer bzw. seiner Leitung stehen, innerhalb ihres bzw. seines Aufgabenbereiches an.
#4.6
1 Musikalische Veranstaltungen im Zuständigkeitsbereich der Kirchenmusikerin bzw. des Kirchenmusikers, die nicht von ihr bzw. ihm initiiert worden sind, bedürfen der rechtzeitigen und einvernehmlichen Absprache mit der Kirchenmusikerin bzw. dem Kirchenmusiker. 2 Ist Einvernehmen nicht zu erzielen, entscheidet die Dienstaufsicht führende Stelle unter Einbeziehung der Fachberatung abschließend.
#5. Ermittlung des Stellenumfangs
#5.1
1 Der Dienstgeber bestimmt, welche kirchenmusikalischen Arbeitsbereiche der Kirchenmusikerin bzw. dem Kirchenmusiker übertragen werden (§ 13 Absatz 3 KMusG). 2 Die Berechnung der Arbeitszeiten für die einzelnen Arbeitsbereiche obliegt der Fachberatung. 3 Bei A- und B-Stellen liegt die Fachberatung gemäß § 7 Absatz 2 KMusG bei der Landeskirchenmusikdirektorin bzw. dem Landeskirchenmusikdirektor.
#5.2
Das Üben am Hauptinstrument der Kirchenmusikerin bzw. des Kirchenmusikers muss in angemessener Weise im Rahmen ihrer bzw. seiner Tätigkeit und des jeweiligen Dienstumfangs gewährleistet sein.
#5.3
1 Regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten sind:
- Das Musizieren an der Orgel oder anderen Instrumenten in Gottesdiensten und bei Kasualien. Dazu gehören beispielsweise die Vorbereitung und die Begleitung des Gemeindegesangs sowie die Improvisation.
- Die Arbeit mit Chor- und Instrumentalgruppen. Dazu gehören beispielsweise der regelmäßige Probenbetrieb, Literaturauswahl, Analyse, Didaktik und Methodik, Arrangement, Dirigiertechnik, Stimmbildung und Partiturspiel.
2 Für diese Tätigkeiten sind außer der tatsächlichen Ausführungszeit angemessene Zusatzzeiten für Vorbereitung und Planung zu berücksichtigen. 3 Als angemessen gilt in der Regel ein pauschales Verhältnis von einem Drittel tatsächlicher Ausführungszeit und zwei Dritteln Zusatzzeit, mindestens aber ein Verhältnis von 1:1.
#5.4
1 Ständige Tätigkeiten sind:
- Die Erarbeitung von Werken der Literatur am Instrument und die Pflege der Improvisation.
- Das Üben am Instrument zur Erhaltung der persönlichen Spielfähigkeit und der allgemeinen musikalischen Kompetenz.
- Die Vorbereitung von Vokal- und Instrumentalkonzerten. Dazu gehören beispielsweise Programmkonzeption, Einrichten von Chor- und Orchestermaterial, Verpflichtung der Mitwirkenden, Solistenproben.
- Die Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktpflege.
- Die Gewinnung neuer Chormitglieder sowie Instrumentalistinnen und Instrumentalisten.
2 Diese Tätigkeiten sind durch den regelmäßigen Probenbetrieb (Nummer 5.2) nicht abgedeckt und werden bei einer Kirchenmusikstelle in Vollzeitbeschäftigung mit einer pauschalen Sockelarbeitszeit von mindestens acht Stunden wöchentlich angesetzt. 3 Bei Kirchenmusikstellen in Teilzeitbeschäftigung ist eine Reduzierung der Sockelarbeitszeit grundsätzlich nicht ausgeschlossen; dabei muss der Kirchenmusikerin bzw. dem Kirchenmusiker eine angemessene Zeit für die ständigen Tätigkeiten verbleiben.
#5.5
Nicht ständige Tätigkeiten sind:
- Die Durchführung von Vokal- und Orgelkonzerten sowie anderen Instrumentalkonzerten. Für die Tätigkeiten wird die tatsächlich aufgewendete Arbeitszeit angesetzt.
- Die Durchführung von Freizeiten für Chor- und Instrumentalgruppen. Wegen der Arbeitszeiten ist § 10 Absatz 5 Tarifvertrag für Kirchliche Beschäftigte in der Nordkirche (TV KB) zu beachten.
5.6
1 Weitere Tätigkeiten sind:
- Die Mitwirkung bei gemeindlichen Veranstaltungen. Dazu gehört beispielsweise das Musizieren bei Gemeindefesten und Seniorennachmittagen.
- Tätigkeiten außerhalb des musikalischen Bereichs: Mitwirkung bei szenischen Aufführungen. Dazu gehören beispielsweise die Bühnengestaltung, Kostüme und Maske.
- Die Teilnahme an Dienstbesprechungen.
- Die Pflege der Instrumente.
- Die Gremienarbeit.
- Die Organisation und Begleitung von Gastkonzerten.
2 Für diese Tätigkeiten ist jeweils der tatsächliche Zeitaufwand als Arbeitszeit anzusetzen.
#5.7
Das Vorgehen bei der Berechnung des Stellenumfangs ergibt sich aus der Anlage zu dieser Verwaltungsvorschrift.
##6. Arbeitszeiten
#6.1
1 Für eine Kirchenmusikerin bzw. einen Kirchenmusiker in Vollzeitbeschäftigung ist ein Werktag in der Woche im Dienstplan als arbeitsfrei schriftlich zu vereinbaren. 2 Zudem ist ein Wochenende im Kalendervierteljahr arbeitsfrei zu halten (§ 5 Absatz 5 Satz 5 TV KB); die wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden ist in dieser Woche auf die Wochentage Montag bis Freitag zu verteilen.
#6.2
1 Ist eine Kirchenmusikstelle nicht als Vollzeitstelle ausgewiesen, sind die Arbeitszeiten so festzulegen, dass der Kirchenmusikerin bzw. dem Kirchenmusiker die Ausübung einer zweiten beruflichen Tätigkeit möglich ist. 2 Hierauf ist besonders bei der zeitlichen Ansetzung von Kasualien Rücksicht zu nehmen. 3 Die wöchentlichen Arbeitstage sind schriftlich zu vereinbaren.
#6.3
Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker gestaltet das kirchenmusikalische Leben in ihrem bzw. seinem Zuständigkeitsbereich im Umfang ihrer bzw. seiner dienstlichen Verpflichtungen unter Beachtung des geltenden Rechts selbstständig und eigenverantwortlich (§ 13 Absatz 2 Satz 2 KMusG).
#6.4
Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen sind die Ordnungen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
7. Arbeitsmittel
#7.1
1 Der Kirchenmusikerin bzw. dem Kirchenmusiker ist für die kirchenmusikalische Arbeit ein geeigneter Probenraum zur Verfügung zu stellen. 2 Zudem soll der Kirchenmusikerin bzw. dem Kirchenmusiker mit einer Vollzeitbeschäftigung ein geeigneter Büroraum zur Verfügung gestellt werden. 3 Bei einer Teilzeitbeschäftigung der Kirchenmusikerin bzw. des Kirchenmusikers soll ein geeigneter Arbeitsplatz vorgehalten werden.
#7.2
1 Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker ist für ihren bzw. seinen Aufgabenbereich der Kirchenmusik in die Haushaltsplanungen einzubeziehen. 2 Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker informiert in Form einer Jahresplanung über ihre bzw. seine Tätigkeit, dazu soll auch die Aufstellung eines Finanzplans gehören.
#7.3
1 Die im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel für die Kirchenmusik verwaltet die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker selbstständig. 2 Zu den Haushaltsmitteln für die Kirchenmusik gehören beispielsweise die Kosten für Chor- und Instrumentalgruppen, Honorare für Solistinnen und Solisten sowie Instrumentalistinnen und Instrumentalisten, Noten und die Instrumentenpflege. 3 Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker kann für ihren bzw. seinen Aufgabenbereich Anträge zum Haushaltsplan stellen.
#7.4
Noten und Bücher sind geordnet und sorgfältig aufzubewahren.
#7.5
Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker hat im Rahmen der in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland geltenden Bestimmungen Anspruch auf Erstattung der im Zusammenhang mit ihrer bzw. seiner dienstlichen Tätigkeit entstandenen Auslagen.
#8. Musikinstrumente
#8.1
Der Kirchenmusikerin bzw. dem Kirchenmusiker sind die für ihre bzw. seine Arbeit benötigten Instrumente zur Verfügung zu stellen.
#8.2
Die Instrumente sind zu inventarisieren.
#8.3
1 Der Kirchenmusikerin bzw. dem Kirchenmusiker sind die ihr bzw. ihm zur Verfügung gestellten Instrumente zu eigenen Übungszwecken unentgeltlich zur Nutzung zu überlassen. 2 Sollen die Instrumente Dritten zur Nutzung dienen, so entscheidet darüber die Eigentümerin bzw. der Eigentümer unter Beteiligung der Kirchenmusikerin bzw. des Kirchenmusikers.
#8.4
Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker ist im Rahmen ihres bzw. seines jeweiligen Aufgabenbereichs dafür verantwortlich, dass die Orgel und die anderen Instrumente der Gemeinde stets in gutem Zustand sind.
#8.5
1 Beschädigungen an den Instrumenten und die Gefährdung der Instrumente durch äußere Einflüsse sind dem Dienstgeber anzuzeigen. 2 Beschädigungen oder Gefährdungen können beispielsweise durch Bauschäden, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Trockenheit und übermäßige Temperaturschwankungen entstehen.
#8.6
1 Der Dienstgeber sorgt für Abhilfe von Beschädigungen oder Gefährdung. 2 Bei Beeinträchtigung der Orgel beauftragt er eine Orgelsachverständige bzw. einen Orgelsachverständigen zur Beratung.
#9. Urlaub und Vertretung
#9.1
1 Für die Gewährung des Urlaubs wird bei einer Kirchenmusikerin bzw. einem Kirchenmusiker in Vollzeitbeschäftigung eine Sechs-Tage-Woche zugrunde gelegt. 2 Das entspricht 36 Urlaubstagen im Kalenderjahr (§ 19 TV KB).
#9.2
1 Die Regelung in Nummer 9.1 gilt auch für die Kirchenmusikerin bzw. den Kirchenmusiker in Teilzeitbeschäftigung, sofern keine festen Arbeitstage vereinbart wurden. 2 Wird von einer Sechs-Tage-Woche abgewichen, verringern sich die Urlaubstage entsprechend (§ 19 TV KB).
#9.3
1 Nach § 15 KMusG ist der Urlaub rechtzeitig im Einvernehmen mit dem Dienstgeber festzulegen. 2 Der Urlaub soll außerhalb der kirchlichen Festzeiten genommen werden.
#9.4
1 Während des Urlaubs und der fest vereinbarten freien Tage (Nummer 6.1) muss die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker nicht erreichbar sein. 2 Der Dienstgeber sorgt nach § 15 Absatz 2 KMusG für die Vertretung der Kirchenmusikerin bzw. des Kirchenmusikers bei deren bzw. dessen Abwesenheit. 3 Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker ist verpflichtet, den Dienstgeber bei der Regelung des Vertretungsdienstes zu unterstützen.
#10. Urheberrechtliche Vorschriften
#10.1
Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker ist verpflichtet, die aufgrund urheberrechtlicher Vorschriften beizubringenden statistischen Unterlagen über die Aufführung von Musikwerken in Gottesdiensten und kirchenmusikalischen Veranstaltungen zusammenzustellen und für die ordnungsgemäße Weitergabe an die zuständige Stelle zu sorgen.
#10.2
Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker ist zur Mitwirkung an den erforderlichen Meldungen an die Verwertungsgesellschaften verpflichtet.
#11. Beratung
1 Die Kirchenmusikerin bzw. der Kirchenmusiker erhält in allen den kirchenmusikalischen Dienst betreffenden Fragen Rat und Förderung durch die Kreiskantorin bzw. den Kreiskantor (§ 18 Absatz 3 Satz 1 KMusG). 2 In Absprache mit der Kreiskantorin bzw. dem Kreiskantor kann in Einzelfällen auch eine Beratung durch die Landeskirchenmusikdirektorin bzw. den Landeskirchenmusikdirektor erfolgen (§ 20 Absatz 4 Satz 2 KMusG).
#12. Schlussbestimmungen
#12.1
Der Dienstgeber kann nach Beratung durch die Kreiskantorin bzw. den Kreiskantor diese Verwaltungsvorschrift durch eine Dienstanweisung ergänzen.
#12.2
Bestehende Dienstanweisungen sind dieser Verwaltungsvorschrift zum nächstmöglichen Zeitpunkt anzupassen.
#13. Inkrafttreten, Außerkrafttreten
1 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2 Gleichzeitig treten folgende Bestimmungen außer Kraft:
Die Ordnung für den Dienst der hauptberuflichen Kirchenmusiker (Allgemeine Dienstanweisung) vom 15. Juni 2010 (KABl. S. 57) der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs,
die Ordnung für die Anstellung hauptberuflicher Kirchenmusiker vom 16. April 1966 (KABl. S. 40) der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs,
die Mindestanforderungen an eine Kirchgemeinde, bei der ein Kirchenmusiker angestellt werden soll oder bereits angestellt ist vom 15. April 1992 (KABl. S. 65) der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs,
die Orientierung für die Arbeitszeitberechnung für Kirchenmusikalische Dienste hauptberuflicher Kirchenmusiker vom 10. September 1993 (ABl. 1993 S. 128) der ehemaligen Pommerschen Evangelischen Kirche,
die Allgemeine Dienstordnung für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche vom 10. Februar 2009 in der Fassung vom 29. Januar 2010 (GVOBl. S. 54).
Kiel, 7. Februar 2025 | ||||
Landeskirchenamt | ||||
Professor Dr. Unruh Präsident | ||||
Az.: 6200-008/005 – T Sk/DAR Ls | ||||
* | ||||
Anlage zu Nummer 5.7
der Verwaltungsvorschrift für Kirchenmusikerinnen bzw. der Kirchenmusiker
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(Allgemeine Dienstordnung)
der Verwaltungsvorschrift für Kirchenmusikerinnen bzw. der Kirchenmusiker
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(Allgemeine Dienstordnung)
Vorgehen bei der Berechnung des Stellenumfangs
Vorbemerkung:
1 Nach § 5 Absatz 1 und 2 TV KB beträgt die wöchentliche Arbeitszeit bei einer Vollzeitstelle 39 Stunden, verteilt auf regelmäßig fünf Tage in der Woche. 2 Davon kann abgewichen werden, wenn notwendige dienstliche Gründe vorliegen. 3 Da Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker ihren Dienst insbesondere auch an Wochenenden und kirchlichen Feiertagen erbringen, werden sämtliche Dienste eines Jahres in einer Berechnung aufgrund von Jahresarbeitsstunden erfasst.
4 Für die Berechnung des Stellenumfangs einer Vollzeitstelle wird die Jahresarbeitszeit wie folgt zugrunde gelegt: Die Brutto-Jahresarbeitszeit beträgt 2.035 Stunden (§ 6 Absatz 3 TV KB).
5 Unter Berücksichtigung von Erholungsurlaub und gesetzlichen Feiertagen ergibt sich daraus eine Netto-Jahresarbeitszeit für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker von 1723 Stunden.
6 Alle Tätigkeiten in ihrem tatsächlichen bzw. angenommenen Aufkommen sind als Dienstzeiten nach Nummer 5 zu erfassen. 7 Die Summe der Dienstzeiten muss der Netto-Jahresarbeitszeit entsprechen.
8 Für die Verteilung der Dienstzeiten gilt Nummer 6.3.
9 Bei Teilzeitstellen ist die Netto-Jahresarbeitszeit entsprechend prozentual zu verringern.
Nr. 12Verwaltungsvorschrift
über den Arbeits- und Gesundheitsschutz
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(AuGVwV)
über den Arbeits- und Gesundheitsschutz
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(AuGVwV)
Vom 11. Februar 2025
Das Landeskirchenamt hat aufgrund von Artikel 105 Absatz 2 Nummer 3 der Verfassung die folgende Verwaltungsvorschrift erlassen:
###1. Grundsatz
1 Diese Verwaltungsvorschrift dient der Umsetzung und Ergänzung
- der staatlichen Bestimmungen zum Arbeitsschutz, insbesondere
- des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885) (ASiG) das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, und
- des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), das zuletzt durch Artikel 32 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, sowie
- des berufsgenossenschaftlichen Regelwerks, insbesondere
- der Unfallverhütungsvorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherungen „Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) und „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2), in den jeweils geltenden Fassungen, sowie
- der von der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) mit der Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zur Umsetzung eines Präventionskonzepts „Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Evangelischen Kirche in Deutschland“ (Rahmenvereinbarung-EKD) vom 21. Mai 2014 (ABl. EKD 2018 S. 98), in der jeweils geltenden Fassung, der die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland beigetreten ist.
2 Arbeitsschutz im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift umfasst die Arbeitssicherheit, die Unfallverhütung und den Gesundheitsschutz. 3 Sein Ziel ist es, sicherheits- und gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeitenden nach Nummer 2.2 zu etablieren, zu sichern und zu verbessern.
#2. Geltungsbereich
#2.1
Diese Verwaltungsvorschrift verpflichtet die öffentlich-rechtlichen Körperschaften in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und ihre rechtlich unselbständigen Dienste und Werke (Anstellungsträger).
#2.2
1 Der Schutzbereich dieser Verwaltungsvorschrift erstreckt sich entsprechend zu § 2 Absatz 2 ArbSchG auf alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die bei den Anstellungsträgern nach Nummer 2.1 tätig sind (Mitarbeitende). 2 Dies sind insbesondere
- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
- Auszubildende,
- Pastorinnen und Pastoren,
- Vikarinnen und Vikare,
- Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte,
- ehrenamtlich Tätige.
3. Verantwortung als Anstellungsträger
#3.1
1 Jeder Anstellungsträger ist verpflichtet, den Arbeitsschutz für die bei ihm tätigen Mitarbeitenden zu gewährleisten. 2 Er ist gemäß § 2 Absatz 3 ArbSchG Arbeitgeber im Sinne des Arbeitsschutzes.
#3.2
1 Neben dem Anstellungsträger sind gemäß § 13 ArbSchG seine gesetzliche Vertreterin bzw. sein gesetzlicher Vertreter oder sein vertretungsberechtigtes Organ für den Arbeitsschutz verantwortlich. 2 Darüber hinaus kann der Anstellungsträger seine Verantwortung für den Arbeitsschutz gemäß § 13 Absatz 2 ArbSchG schriftlich an zuverlässige und fachkundige Personen delegieren. 3 Das Landeskirchenamt stellt für die Delegation ein Muster zur Verfügung. 4 Der Anstellungsträger bleibt für die Überwachung der ordnungsgemäßen und sorgfältigen Erfüllung der delegierten Aufgaben verantwortlich.
#3.3
Die Kirchenkreise beraten gemäß der Anlage zu § 2 Absatz 2 Satz 1 des Kirchenkreisverwaltungsgesetzes vom 15. November 2016, zuletzt geändert am 29. November 2022 (KKVwG), in der jeweils geltenden Fassung, die Arbeitgeber und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Zuständigkeitsbereich im Bereich des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit.
#3.4
Die Mitarbeitendenvertretung hat bei Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und gesundheitlichen Gefahren gemäß § 40 Buchstabe b Mitarbeitendenvertretungsgesetz der EKD – MVG-EKD vom 12. November 2013, zuletzt geändert am 13. November 2024 (ABl. EKD S. 157), in der jeweils geltenden Fassung, ein Mitbestimmungsrecht.
#4. Arbeitsschutzbeauftragte
#4.1
1 Jeder Anstellungsträger soll für die Belange des Arbeitsschutzes mindestens eine Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprechpartner (Arbeitsschutzbeauftragte) beauftragen, der bzw. dem die Schnittstellenfunktion zwischen den arbeitgeberseitig verantwortlichen Personen nach Nummer 3.2, den Mitarbeitenden nach Nummer 2.2 und den unterstützenden und beratenden Personen (Sicherheitsbeauftragte nach Nummer 5, Orts- und Fachkräfte nach Nummer 8, der leitenden Fachkraft für Arbeitssicherheit nach Nummer 7, der Landeskirchlichen Koordinatorin bzw. dem Landeskirchlichen Koordinator für Arbeitssicherheit nach Nummer 6) zukommt. 2 Die bzw. der Arbeitsschutzbeauftragte trägt nur dann die arbeitgeberseitige Verantwortung für den Arbeitsschutz, wenn sie bzw. er mit der verantwortlichen Person des Anstellungsträgers gemäß Nummer 3.2 identisch ist oder ihr bzw. ihm klar definierte Verantwortungsbereiche übertragen wurden. 3 Die Arbeitsschutzbeauftragten sind den Mitarbeitenden sowie der Landeskirchlichen Koordinatorin bzw. dem Landeskirchlichen Koordinator für Arbeits- und Gesundheitsschutz namentlich bekannt zu machen.
#4.2
1 Die Beauftragung, Festlegung des Verantwortungsbereichs und der Befugnisse erfolgen durch eine Pflichtenübertragung in Textform. 2 Das Landeskirchenamt stellt für die Pflichtenübertragung ein Muster zur Verfügung. 3 Zu den Aufgaben der bzw. des Arbeitsschutzbeauftragten können insbesondere gehören:
- Durchführung der Gefährdungsbeurteilung,
- angemessene und ausreichende Unterweisung der Mitarbeitenden über den Arbeitsschutz,
- Voranbringen von Maßnahmen, die die Sicherheit und die Gesundheit der Mitarbeitenden bei der Arbeit gewährleisten,
- Überprüfung dieser Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit und erforderlichenfalls die Unterstützung ihrer Anpassung an geänderte Gegebenheiten,
- Sicherstellung der erforderlichen örtlichen Begehungen und Beratungen durch die Ortskräfte (vgl. Nummer 8),
- Koordination und gegebenenfalls Leitung der Arbeitsschutzausschüsse im Zuständigkeitsbereich und
- Meldung von Arbeitsunfällen an die jeweilige Ortskraft (vgl. Nummer 8).
4 Bei der Erfüllung dieser Aufgaben wird die bzw. der Arbeitsschutzbeauftragte von der zuständigen Fach- oder Ortskraft (vgl. Nummer 8) für Arbeitssicherheit beratend unterstützt.
#4.3
Die Arbeitsschutzbeauftragten sollen regelmäßig zu Fragestellungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz fortgebildet werden.
#4.4
Soweit die Aufgaben des Arbeitsschutzes nicht in Textform an eine Arbeitsschutzbeauftragte bzw. einen Arbeitsschutzbeauftragten übertragen wurden, bleibt die verantwortliche Person des Anstellungsträgers gemäß Nummer 3.2 für diese zuständig.
#5. Sicherheitsbeauftragte
1 Sicherheitsbeauftragte im Sinne des § 22 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254) (SGB 7), das zuletzt durch Artikel 66 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, unterstützen den Anstellungsträger bei der Durchführung von Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. 2 Sie haben sich von dem Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und persönlicher Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Mitarbeitenden im Sinne von Nummer 2.2 aufmerksam zu machen. 3 Sie werden entsprechend § 22 Absatz 1 SGB 7 von Anstellungsträgern mit regelmäßig mehr als 20 bei ihnen tätigen Mitarbeitenden i. S. d. Mitarbeitendenvertretungsrechts unter Beteiligung der Mitarbeitendenvertretung bestellt. 4 Das Landeskirchenamt stellt für ihre Bestellung ein Muster zur Verfügung.
#6. Landeskirchliche Koordinatorin bzw. Landeskirchlicher Koordinator für Arbeits- und Gesundheitsschutz
#6.1
1 Vom Landeskirchenamt wird gemäß Nummer 4 Rahmenvereinbarung-EKD schriftlich eine Landeskirchliche Koordinatorin bzw. ein Landeskirchlicher Koordinator für Arbeits- und Gesundheitsschutz bestellt. 2 Sie bzw. er ist die zentrale Ansprechperson der Landeskirche für den Arbeits- und Gesundheitsschutz, u. a. gegenüber den Anstellungsträgern, den Arbeitsschutzbeauftragten, dem Gesamtausschuss der Mitarbeitendenvertretungen, den Orts- und Fachkräften für Arbeitssicherheit, den staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Aufsichtsbehörden sowie der Evangelischen Fachstelle für Arbeitssicherheit (EFAS).
#6.2
Die Koordinatorin bzw. der Koordinator vertritt die Landeskirche im Kreise aller Koordinatorinnen bzw. Koordinatoren für Arbeits- und Gesundheitsschutz in der EKD, gegenüber der EFAS sowie den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung im Rahmen ihrer bzw. seiner Bestellung.
#6.3
1 Die Aufgaben der Koordinatorin bzw. des Koordinators sind in Nummer 4.1 bis 4.3 Rahmenvereinbarung-EKD genannt. 2 Sie bzw. er hat den Arbeits- und Gesundheitsschutz weiterzuentwickeln und Entscheidungen der Landeskirche im Hinblick auf eine Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes zu fördern und umzusetzen, insbesondere durch die Unterstützung bei der laufenden Weiterentwicklung des Arbeits- und Gesundheitsschutzkonzeptes. 3 Ihr bzw. ihm sind auf Aufforderung die erforderlichen Kennzahlen für die Ermittlung des Betreuungsbedarfs durch die Orts- und Fachkräfte zur Erstellung von Arbeitsunfall- und Gesundheitsstatistiken zu übermitteln.
#7. Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit
#7.1
1 Vom Landeskirchenamt wird gemäß Nummer 5 Rahmenvereinbarung-EKD schriftlich eine leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt. 2 Sie hat die fachliche Aufsicht über die Orts- und Fachkräfte für Arbeitssicherheit und unterstützt sie mit ihrer Fachkunde. 3 Sie muss die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit absolviert haben und mindestens zu 50 Prozent des Beschäftigungsumfangs einer vergleichbaren vollbeschäftigten Mitarbeiterin bzw. eines vergleichbaren vollbeschäftigten Mitarbeiters als Fachkraft für Arbeitssicherheit tätig sein. 4 In diesem Beschäftigungsumfang ist die Beratungstätigkeit als Fach- bzw. Ortskraft für Arbeitssicherheit für landeskirchliche Einrichtungen enthalten.
#7.2
1 In der Regel soll gemäß Nummer 4 Rahmenvereinbarung-EKD die Landeskirchliche Koordinatorin bzw. der Landeskirchliche Koordinator gleichzeitig die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit der Landeskirche sein. 2 Ist dies ausnahmsweise nicht der Fall, arbeiten Koordinatorin oder Koordinator und die leitende Fachkraft eng zusammen. 3 In fachlichen Belangen hat in diesem Fall die leitende Fachkraft, in organisatorischen und konzeptionellen Belangen die Koordinatorin bzw. der Koordinator die Entscheidungskompetenz.
#8. Orts- und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
#8.1
1 Die Anstellungsträger haben gemäß § 5 ASiG schriftlich Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen, die sie gemäß § 6 ASiG beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit unterstützen. 2 In Abweichung von dieser Regelung wurde gemäß § 16 ASiG i. V. m. § 2 Absatz 6 DGUV Vorschrift 2 mit der Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) in Nummer 5 Rahmenvereinbarung-EKD vereinbart, dass die Anstellungsträger unter den dort genannten Voraussetzungen durch die Bestellung von Ortskräften einen zu §§ 5 und 6 ASiG analogen gleichwertigen arbeitssicherheitstechnischen Arbeitsschutz gewährleisten können und diese abweichende Festsetzung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. 3 Für die Kirchengemeinden erfolgt die Betreuung entsprechend Nummer 1.1.6 der Anlage zu § 2 Absatz 2 Satz 1 KKVwG durch die Fach- bzw. Ortskräfte der Kirchenkreise. 4 Innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland ist für jede Einrichtung eine von der Landeskirche oder den Kirchenkreisen mit Bestellungsurkunde berufene Fach- bzw. Ortskraft mit entsprechender fachlicher Qualifikation zuständig.
#8.2
1 Wurde eine Ortskraft anstelle einer Fachkraft bestellt, übernimmt sie unter fachlicher Anleitung und Betreuung durch die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit (Nummer 7) die Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit entsprechend § 6 ASiG. 2 Zu diesen gehören insbesondere die
- Durchführung von Ortsbegehungen und Beratung der Anstellungsträger in Fragen des Arbeitsschutzes,
- Beratung der Anstellungsträger bei Veranstaltungen zu Themen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes,
- beratende Unterstützung der Arbeitsschutzbeauftragten bei ihren Aufgaben nach Nummer 4.2,
- Mitwirkung im Arbeitsschutzausschuss.
9. Arbeitsschutzausschüsse
#9.1
1 In den entsprechend § 11 ASiG gebildeten Arbeitsschutzausschüssen werden mindestens vierteljährlich die mit dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung befassten Funktionsträger zusammengebracht, um Anliegen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beraten. 2 Zu diesen Anliegen gehören auch das Betriebliche Gesundheitsmanagement, die Barrierefreiheit oder die Verkehrssicherungspflicht von öffentlich zugänglichen Bereichen. 3 Die Orts- und Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Betriebsärztinnen und -ärzte bringen ihr sicherheitstechnisches und arbeitsmedizinisches Fachwissen ein.
#9.2
1 Die Besetzung der Ausschüsse erfolgt entsprechend § 11 Satz 2 ASiG mit folgenden Mitgliedern:
- Vertreterin bzw. Vertreter des Anstellungsträgers gemäß Nummer 3.2,
- zwei von der Mitarbeitendenvertretung bestimmte Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung,
- Betriebsärztin bzw. Betriebsarzt,
- Orts- oder Fachkraft für Arbeitssicherheit gemäß Nummer 8,
- Sicherheitsbeauftragte bzw. Sicherheitsbeauftragter gemäß Nummer 5.
2 Zusätzlich nehmen die Arbeitsschutzbeauftragten nach Nummer 4 an den Ausschusssitzungen teil. 3 Die Landeskirchliche Koordinatorin bzw. der Landeskirchliche Koordinator für Arbeitsschutz wirkt in den Arbeitsschutzausschüssen gemäß Nummer 4.3 Rahmenvereinbarung-EKD mit. 4 Bei Bedarf werden weitere Fachleute zu den Sitzungen eingeladen.
#9.3
In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland werden entsprechend § 11 Satz 1 ASiG mindestens folgende Arbeitsschutzausschüsse gebildet:
- ein Arbeitsschutzausschuss je Kirchenkreis,
- ein Arbeitsschutzausschuss für die landeskirchliche Ebene, soweit nicht gemäß der folgenden Nummern 3 und 4 eigene Arbeitsschutzausschüsse erforderlich sind,
- ein Arbeitsschutzausschuss der Hauptbereiche,
- in Einrichtungen mit mehr als 20 Mitarbeitenden sollen weitere Arbeitsschutzausschüsse eingerichtet werden.
9.4
Die Arbeitsschutzausschüsse können den Anstellungsträgern Empfehlungen für Maßnahmen geben, über deren tatsächliche Umsetzung die jeweilige Dienststellenleitung unter Beteiligung der jeweils zuständigen Mitarbeitendenvertretung entscheidet.
#9.5
1 Die bzw. der Vorsitzende des Arbeitsschutzausschusses lädt mindestens einmal im Quartal mit einer Frist von vier Wochen zur Sitzung ein. 2 Es ist ein Protokoll anzufertigen, von dem die Landeskirchliche Koordinatorin bzw. der Landeskirchlicher Koordinator für Arbeits- und Gesundheitsschutz eine Abschrift erhält.
#10. Landeskirchliches Arbeitsschutzgremium
#10.1
1 Das Landeskirchliche Arbeitsschutzgremium hat die Aufgabe, sich mit übergreifenden Grundsatzfragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der Unfallverhütung als zentrales landeskirchliches Thema in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Norddeutschland auf den Ebenen der Landeskirche, der Kirchenkreise und Kirchenkreisverbänden, der Kirchengemeinden und den Kirchengemeindeverbänden sowie den ihnen jeweils angeschlossenen Einrichtungen zu befassen. 2 Es entwickelt und prüft Maßnahmen zur Etablierung, Sicherung und Verbesserung von sicherheits- und gesundheitsgerechten Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeitenden nach Nummer 2.2 in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und regt gegebenenfalls Veränderungen des Arbeitsschutzkonzeptes an.
#10.2
1 Das Landeskirchliche Arbeitsschutzgremium setzt sich aus folgenden Personen zusammen:
- dezernatsleitende Person des Dezernats Bauwesen (Leitung),
- Person für Arbeits- und Gesundheitsschutz aus der Mitte der Kirchenleitung,
- Landeskirchliche Koordinatorin bzw. Landeskirchlicher Koordinator für Arbeits- und Gesundheitsschutz (Geschäftsführung),
- Landeskirchliche Koordinatorin bzw. Landeskirchlicher Koordinator für Arbeitsmedizin,
- eine Vertretung des Vorstandes des Gesamtausschusses der Mitarbeitendenvertretungen,
- eine von der Pastorinnen- und Pastorenvertretung entsandte Person,
- vorsitzende Personen der Arbeitsschutzausschüsse der Kirchenkreise oder eine von den Arbeitsschutzausschüssen bestimmte Vertretung aus ihrem Teilnehmerkreis,
- eine von der Gesamtkonferenz der Hauptbereiche benannte Person,
- eine weitere Vertretung des Landeskirchenamtes (Büroleitung Dezernat L oder Vertretung).
2 Weitere Mitglieder aus den Kirchenkreisen bzw. den kirchlichen Verwaltungen können zu Beratungen hinzugezogen werden.
#10.3
1 Das Landeskirchliche Arbeitsschutzgremium tritt mindestens einmal jährlich zusammen. 2 Die Geschäftsführung lädt mit einer Frist von vier Wochen ein. 3 Es wird ein Protokoll angefertigt. 4 Die Reisekosten trägt die Landeskirche.
#11. Übergangsvorschrift
Die Arbeitsschutzbeauftragten nach Nummer 4 sollen der Landeskirchlichen Koordinatorin bzw. dem Landeskirchlichen Koordinator bis zum 31. Dezember 2025 bekannt gegeben werden.
#12. Außerkrafttreten
Die Allgemeine Verwaltungsanordnung über die Durchführung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz (VerwAnO-ASch) vom 26. Mai 1999 (GVOBl. S. 138) tritt außer Kraft.
#13. Inkrafttreten
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Kiel, 11. Februar 2025 | ||||
Landeskirchenamt | ||||
Susanne Böhland Vizepräsidentin | ||||
Az.: 3637-001 – DAR VS/BAS Mai | ||||
Nr. 13Beschluss
der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
zur zweiten Verlängerung des Erprobungszeitraums
der Grundlinien kirchlichen Handelns bei Taufe und Abendmahl
sowie bei Gottesdiensten anlässlich der Konfirmation,
der Eheschließung (Trauung) und der Bestattung
der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
zur zweiten Verlängerung des Erprobungszeitraums
der Grundlinien kirchlichen Handelns bei Taufe und Abendmahl
sowie bei Gottesdiensten anlässlich der Konfirmation,
der Eheschließung (Trauung) und der Bestattung
Vom 30. Januar 2025
##Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland hat auf ihrer Tagung vom 25. bis 28. September 2024 im Rahmen ihrer Befugnis nach Artikel 78 Absatz 3 Nummer 1 der Verfassung beschlossen, Nummer 3 des Beschlusses der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland über eine Phase der Erprobung des Entwurfs der „Grundlinien kirchlichen Handelns bei Taufe und Abendmahl sowie bei Gottesdiensten anlässlich der Konfirmation, der Eheschließung (Trauung) und der Bestattung“ vom 4. Dezember 2019 (KABl. 2020 S. 26), geändert durch Beschluss der Landessynode vom 8. Dezember 2021 (KABl. 2022 S. 8), wie folgt zu verändern:
„3. Der Erprobungszeitraum beginnt am 1. Januar 2020 und endet am 31. Dezember 2025. Vor dem Ende des Erprobungszeitraums findet eine geordnete Auswertung statt, in die auch Stellungnahmen der Kirchengemeinden, die die Grundlinien 2019 nicht für sich zur Anwendung gebracht haben, einbezogen werden. Es ist vorgesehen, dass die Landessynode auf ihrer Tagung im September 2025 nach Artikel 78 Absatz 3 Nummer 1 Verfassung über die Einführung der Grundlinien 2019 als einheitliches Recht der Nordkirche beschließt.“
Kiel, 30. Januar 2025 | ||||
Präsidium der Landessynode | ||||
Ulrike Hillmann Präses | ||||
Az.: 6130-002 T An | ||||
Nr. 14Berichtigung des
Vierten Kirchengesetzes zur Änderung der Verfassung
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
Vierten Kirchengesetzes zur Änderung der Verfassung
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
Vom 20. Februar 2025
Das Vierte Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland vom 18. Dezember 2024 (KABl. A Nr. 92 S. 268) ist wie folgt zu berichtigen:
In der Eingangsformel sind nach dem Wort „beschlossen“ ein Semikolon und der folgende Halbsatz einzufügen: „Artikel 110 Absatz 3 der Verfassung wurde eingehalten“.
Kiel, 20. Februar 2025 | ||||
Landeskirchenamt Im Auftrag | ||||
Dr. Hassenpflug-Hunger | ||||
Az.: 3101-004/001 – R Hu | ||||
II. Bekanntmachungen
Nr. 15Bekanntgabe der ersten Satzung zur Änderung
der Satzung der rechtsfähigen kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts
„Stiftung Bethanien in Neubrandenburg“
der Satzung der rechtsfähigen kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts
„Stiftung Bethanien in Neubrandenburg“
Vom 28. Januar 2025
Nachstehend wird die vom Vorstand am 28. Januar 2025 beschlossene Satzung der kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts „Stiftung Bethanien in Neubrandenburg“ bekannt gegeben. Die Satzung wurde vom Landeskirchenamt mit Schreiben vom 11. Februar 2025 aufgrund von Teil 1 § 62 Absatz 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes vom 7. Januar 2012 (KABl. S. 30, 127, 234), das zuletzt durch Artikel 1 des Kirchengesetzes vom 18. April 2024 (KABl. A Nr. 34 S. 120) geändert worden ist), in Verbindung mit § 15 Absatz 3 Satz 1 des Kirchengesetzes vom 18. November 2006 über kirchliche Stiftungen in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs (Kirchliches Stiftungsgesetz – KStiftG) (KABl. S. 83 und GVOBl. M-V 2006 S. 863) stiftungsaufsichtlich genehmigt.
Schwerin, 11. Februar 2025 | ||||
Landeskirchenamt Im Auftrag | ||||
Kriedel | ||||
Az.: 0134-060 – R Kr | ||||
* | ||||
Erste Satzung zur Änderung der Satzung der
rechtsfähigen kirchlichen Stiftung öffenlichen Rechts
„Stiftung Bethanien in Neubrandenburg“
Der Vorstand der kirchlichen Stiftung „Stiftung Bethanien in Neubrandenburg“ hat in seiner Sitzung am 28. Januar 2025 folgende, am 1. April 2025 in Kraft tretende Satzungsänderungen beschlossen:
#Artikel 1
Die Satzung der rechtsfähigen kirchlichen Stiftung öffentlichen Rechts „Stiftung Bethanien in Neubrandenburg“ vom 14. November 2019 (KABl. S. 532) wird wie folgt geändert:
- § 5 wird wie folgt geändert:
- Absatz 1 wird durch folgenden Absatz 1 ersetzt:„(1) 1 Das Grundstockvermögen ist im Stiftungsgeschäft ausgewiesen. 2 Der Betrag steht der Stiftung zeitgleich mit der Erteilung der Anerkennung zur Verfügung.“
- Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:„(2) Das Grundstockvermögen ist unangreifbares Stiftungsvermögen.“
- Absatz 3 wird wie folgt geändert:
- aa)
- In Satz 1 wird die Angabe „Stiftungskapital“ durch die Angabe „Grundstockvermögen“ ersetzt.
- bb)
- In Satz 2 wird die Angabe „Stiftungsvermögen“ durch die Angabe „Grundstockvermögen“ ersetzt.
- cc)
- In Satz 3 wird die Angabe „§ 58 Nummer 7a AO dem Stiftungsvermögen“ durch die Angabe „der steuerrechtlichen Bestimmungen der Abgabenordnung dem Grundstockvermögen“ ersetzt.
- In § 6 Absatz 1 wird die Angabe „fünf“ durch die Angabe „vier oder fünf“ ersetzt.
- § 7 wird wie folgt geändert:
- Absatz 1 wird wie folgt geändert:
- aa)
- Satz 1 wird wie folgt geändert:
- aaa)
- In Nummer 4 wird die Angabe „wird,“ durch die Angabe „wird.“ ersetzt.
- bbb)
- Nummer 5 wird gestrichen.
- bb)
- Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt:„Der Vorstand kann beschließen, dass eine Einwohnerin oder ein Einwohner der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, die bzw. der Mitglied einer ACK-Kirche ist, als zusätzliches stimmberechtigtes Mitglied des Vorstandes für die jeweilige Amtszeit berufen wird. Dieser Beschluss kann aus wichtigem Grund mit der einfachen Mehrheit der Vorstandsmitglieder widerrufen werden.“
- Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:„Die Amtszeit der Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 beträgt jeweils sechs Jahre, das Mitglied nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist während der Innehabung seines Amts geborenes Mitglied.“
- In Absatz 4 wird die Angabe „Nummer 2 bis 5“ durch die Angabe „Nummer 2 bis 4“ ersetzt.
Artikel 2
Die Satzungsänderungen treten vorbehaltlich der Genehmigung des Landeskirchenamtes am 1. April 2025 in Kraft.
Neustrelitz, 28. Januar 2025 | ||||
Der Vorstand | ||||
gez. | ||||
Britta Carstensen | ||||
Die Vorsitzende | ||||
Nr. 16Einführung von Kirchensiegeln
Die Einführung des nachstehend abgedruckten Kirchensiegels der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sereetz
ist durch den Kirchenkreisrat des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein genehmigt worden.
Kiel, 17. Februar 2025 | ||||
Landeskirchenamt Im Auftrag | ||||
Wendt | ||||
Az.: 10.9 Sereetz – R We | ||||
Nr. 17Verwendung von Kirchengemeindesiegeln für örtliche Kirchen
Die Kirchenkreisverwaltung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Mecklenburg hat am 6. Februar 2025 folgenden Beschluss des Kirchengemeinderats der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dargun-Neukalen genehmigt:
Für die örtlichen Kirchen
Ev.-Luth. Kirche Brudersdorf
Ev.-Luth. Kirche Dargun
Ev.-Luth. Kirche Groß Methling
Ev.-Luth. St. Johanniskirche Levin
Ev.-Luth. Kirche St. Johannes Neukalen
Ev.-Luth. Kirche Schlakendorf
Ev.-Luth. Kirche Schorrentin
wird ab dem Tag der Bekanntmachung im Kirchlichen Amtsblatt das Kirchensiegel der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dargun-Neukalen
geführt.
Kiel, 11. Februar 2025 | ||||
Landeskirchenamt Im Auftrag | ||||
Thiede | ||||
Az.: 10 Dargun-Neukalen – R Thi | ||||
* | ||||
Die Kirchenkreisverwaltung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Mecklenburg hat am 30. Januar 2025 folgenden Beschluss des Kirchengemeinderats der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ivenack-Stavenhagen genehmigt:
Für die örtlichen Kirchen
Ev.-Luth. Kirche Borgfeld
Ev.-Luth. Kirche Ivenack
Ev.-Luth. Kirche Jürgenstorf
Ev.-Luth. Kirche Pribbenow
Ev.-Luth. Kirche Ritzerow
Ev.-Luth. Kirche Stavenhagen
Ev.-Luth. Kirche Wolde
Ev.-Luth. Kirche Zolkendorf
Ev.-Luth. Kirche Zwiedorf
wird ab dem Tag der Bekanntmachung im Kirchlichen Amtsblatt das Kirchensiegel der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ivenack-Stavenhagen
geführt.
Kiel, 11. Februar 2025 | ||||
Landeskirchenamt Im Auftrag | ||||
Thiede | ||||
Az.: 10 Ivenack-Stavenhagen – R Thi | ||||
* | ||||
Die Kirchenkreisverwaltung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Mecklenburg hat am 6. Februar 2025 folgenden Beschluss des Kirchengemeinderats der Ev.-Luth. Kirche Sanitz genehmigt:
Für die örtliche Kirche
Ev.-Luth. Kirche Sanitz
wird ab dem Tag der Bekanntmachung im Kirchlichen Amtsblatt das Kirchensiegel der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sanitz
geführt.
Kiel, 11. Februar 2025 | ||||
Landeskirchenamt Im Auftrag | ||||
Thiede | ||||
Az.: 10 Sanitz – R Thi | ||||
* | ||||
Die Kirchenkreisverwaltung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Mecklenburg hat am 6. Februar 2025 folgenden Beschluss des Kirchengemeinderats der Ev.-Luth. Kirche Thulendorf genehmigt:
Für die örtliche Kirche
Ev.-Luth. Kirche Thulendorf
wird ab dem Tag der Bekanntmachung im Kirchlichen Amtsblatt das Kirchensiegel der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Thulendorf
geführt.
Kiel, 11. Februar 2025 | ||||
Landeskirchenamt Im Auftrag | ||||
Thiede | ||||
Az.: 10 Thulendorf – R Thi | ||||
Bekanntgabe von Tarifverträgen
Wir veröffentlichen nachstehend folgende vom Verband kirchlicher und diakonischer Dienstgeber in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland e. V. (VKDN) mit der Kirchengewerkschaft Landesverband Nord und der ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) geschlossenen Änderungstarifverträge:
Änderungstarifvertrag Nr. 28 vom 16. Dezember 2024 zum Kirchlichen Tarifvertrag Diakonie (KTD) vom 15. August 2002, bekanntgegeben im Newsletter 13/2024 des VKDN.
Änderungstarifvertrag Nr. 29 vom 16. Dezember 2024 zum Kirchlichen Tarifvertrag Diakonie (KTD) vom 15. August 2002, bekanntgegeben in Newsletter 1/2025 des VKDN.
Kiel, 29. Januar 2025 | ||||
Landeskirchenamt | ||||
Böhland | ||||
Az.: LKA3634-003/006 – DAR Bö | ||||
* | ||||
Nr. 18Änderungstarifvertrag Nr. 28
zum Kirchlichen Tarifvertrag Diakonie (KTD)
vom 15. August 2002
zum Kirchlichen Tarifvertrag Diakonie (KTD)
vom 15. August 2002
Vom 16. Dezember 2024
Zwischen
dem Verband kirchlicher und diakonischer Dienstgeber
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (VKDN)
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (VKDN)
vertreten durch den Vorstand
– einerseits –
und
der Kirchengewerkschaft
Landesverband Nord
Landesverband Nord
vertreten durch den Vorstand
und
der “ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft“ (ver.di),
vertreten durch
die Landesbezirksleitung Hamburg, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg und
die Landesbezirksleitung Nord, Hüxstraße 1–9, 23552 Lübeck
die Landesbezirksleitung Nord, Hüxstraße 1–9, 23552 Lübeck
– andererseits –
wird auf der Grundlage des Tarifvertrags zur Regelung der Grundlagen einer kirchengemäßen Tarifpartnerschaft vom 3. Juni 2021 Folgendes vereinbart:
####§ 1
Änderung des KTD
Der Kirchliche Tarifvertrag Diakonie vom 15. August 2002, zuletzt geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 27 vom 12. Juli 2024, wird wie folgt geändert:
- In § 6 Absatz 7 wird in Satz 6 und in der Protokollnotiz zu Absatz 7 der Begriff „Zeitsparkonto“ durch „Zeitwertkonto“ ersetzt.
- In Anlage 1 Abteilung 1 Nr. 1 wird in Entgeltgruppe E 9 unter A) als Beispiel aufgenommen: „Sozialpädagogin mit staatlicher Anerkennung.“ Unter B) wird „Sozialpädagogin mit staatlicher Anerkennung“ gestrichen.
- In Anlage 1 Abteilung 2 Nr. 1 wird die Entgeltgruppe ES 12 wie folgt gefasst:„Arbeitnehmerin in folgender Funktion:
- Teileinrichtungsleitung
- Bereichsleitung in der Evangelischen Stiftung Alsterdorf“.
- In Anlage 1 Abteilung 2 Nr. 1 wird in Entgeltgruppe ES 13 unter den Ziffern 1 und 2 „mit besonderer Verantwortung“ ersetzt durch „mit herausgehobener Verantwortung“.
- In Anlage 1 Abteilung 2 Nr. 1 wird Satz 1 der Protokollnotiz zu Entgeltgruppe ES 13 wie folgt gefasst:„Das Tätigkeitsmerkmal der herausgehobenen Verantwortung setzt voraus, dass die Arbeitnehmerin aufgrund der Größe und des damit verbundenen Aufgabenbereichs eine deutlich gesteigerte Verantwortung gegenüber der Entgeltgruppe ES 12 wahrnimmt. In der Iuvo gGmbH und dem JugendhilfeNetzwerk Nord-Ost entspricht die Bereichsleitung/Übergeordneter Dienst der Teileinrichtungsleitung mit herausgehobener Verantwortung.“
- In Anlage 1 wird die Protokollnotiz zu Abteilung 2 wie folgt gefasst:„Arbeitnehmerinnen, die in einem geschlossenen Wohnbereich arbeiten, erhalten eine Zulage in Höhe von 150 Euro.“
- In Anlage 1 Abteilung 4 Nr. 1 erhält in Entgeltgruppe EK 6 die Aufzählung unter 1. folgende Fassung:„Spezialbereiche in diesem Sinne sind:
- Stroke Unit
- Operationsdienst
- Anästhesiepflege
- Zentrale Notaufnahme
- Akutpsychiatrie (Protokollnotiz Nr. 2 zu Abteilung 4)
- Geriatrie
- Intensivstation
- Gerontopsychiatrie (Protokollnotiz Nr. 2 zu Abteilung 4)“
- In Anlage 1 Abteilung 4 Nr. 1 wird in der Entgeltgruppe EK 9 in Ziffer 1 der Klammerzusatz hinter dem Spezialbereich Akutpsychiatrie ersetzt durch „(Protokollnotiz Nr. 2 zu Abteilung 4)“.
- In Anlage 1 Abteilung 4 Nr. 1 wird in der Entgeltgruppe EK 9 der Spezialbereich „Geriatrie (ZERCUR)“ gestrichen.
- In Anlage 1 Abteilung 4 Nr. 1 wird in der Entgeltgruppe EK 9 in Ziffer 1 der Spezialbereich Gerontopsychiatrie ergänzt um den Klammerzusatz „(Protokollnotiz Nr. 2 zu Abteilung 4)“.
- In Anlage 1 Abteilung 4 Nr. 1 wird die Entgeltgruppe EK 9 um folgende Ziffer ergänzt:„6. Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe EK 8 Ziffer 1 mit einer Tätigkeit in der Geriatrie und einer abgeschlossenen ZERCUR-Weiterbildung in einem Umfang von weniger als 720 Stunden“.
- Vor der Protokollnotiz zu Abteilung 4 wird die Ziffer 1 eingefügt. Die Protokollnotiz zu Abteilung 4 wird um folgende Nr. 2 ergänzt:„2. Geronto- und Akutpsychiatrien sind Psychiatrien mit geschlossenen Bereichen, in denen Patienten mit Unterbringungsbeschluss untergebracht werden.“
- In Anlage 4 wird Satz 2 in Nr. 1 wie folgt gefasst.„Die §§ 5 und 6 und §§ 8 bis 12 werden ersetzt durch die Nummern 2 und 3 sowie 5 bis 9 dieser Sonderregelung.“In Nr. 3 Absatz 4 Satz 3 wird im 3. Spiegelstrich „in das Zeitsparkonto nach Nr. 4 sofern ein Zeitsparkonto besteht“ ersetzt durch „in das Zeitwertkonto nach § 7 KTD sofern ein Zeitwertkonto besteht“ ersetzt.Nr. 4 wird zum 1. Januar 2025 aufgehoben.
- Anlage 4 wird zum 1. Januar 2026 aufgehoben. Durch eine Dienstvereinbarung kann vereinbart werden, dass die Anlage 4 zu einem früheren Zeitpunkt aufgehoben wird.
§ 2
Inkrafttreten
Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.
Hamburg, 16. Dezember 2024 | ||
Für den Verband kirchlicher und diakonischer Dienstgeber in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (VKDN) | Für die Gewerkschaften | |
gez. Unterschriften | gez. Unterschriften | |
Nr. 19Änderungstarifvertrag Nr. 29
zum Kirchlichen Tarifvertrag Diakonie (KTD)
vom 15. August 2002
zum Kirchlichen Tarifvertrag Diakonie (KTD)
vom 15. August 2002
Vom 16. Dezember 2024
##Zwischen
dem Verband kirchlicher und diakonischer Dienstgeber
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (VKDN)
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (VKDN)
vertreten durch den Vorstand
– einerseits –
und
der Kirchengewerkschaft
Landesverband Nord
Landesverband Nord
vertreten durch den Vorstand
und
der “ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft“ (ver.di),
vertreten durch
die Landesbezirksleitung Hamburg, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg und
die Landesbezirksleitung Nord, Hüxstraße 1–9, 23552 Lübeck
die Landesbezirksleitung Nord, Hüxstraße 1–9, 23552 Lübeck
– andererseits –
wird auf der Grundlage des Tarifvertrags zur Regelung der Grundlagen einer kirchengemäßen Tarifpartnerschaft vom 3. Juni 2021 Folgendes vereinbart:
##§ 1
Änderung des KTD
Der Kirchliche Tarifvertrag Diakonie vom 15. August 2002, zuletzt geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 28 vom 16. Dezember 2024, wird wie folgt geändert:
- In Anlage 1 Abteilung 2 Nr. 1 wird die Protokollnotiz zur Entgeltgruppe ES 12 um folgenden Satz 2 ergänzt:„Die Bereichsleitung/Übergeordneter Dienst in der Iuvo gGmbH und dem JugendhilfeNetzwerk Nord-Ost erhält eine Zulage in Höhe von 50 Prozent der Differenz zur Entgeltgruppe ES 13 in ihrer Entgeltstufe.“
- In Anlage 1 Abteilung 2 Nr. 1 wird die Protokollnotiz zu Entgeltgruppe ES 13 wie folgt gefasst:„Das Tätigkeitsmerkmal der herausgehobenen Verantwortung setzt voraus, dass die Arbeitnehmerin aufgrund der Größe und des damit verbundenen Aufgabenbereichs eine deutlich gesteigerte Verantwortung gegenüber der Entgeltgruppe ES 12 wahrnimmt.“Satz 2 wird gestrichen.
- In Anlage 1 Abteilung 2 Nr. 1 wird ab dem 1. Januar 2026 Satz 2 der Protokollnotiz zur Entgeltgruppe ES 12 gestrichen.
- In Anlage 1 Abteilung 2 Nr. 1 wird die Protokollnotiz zu Entgeltgruppe ES 13 ab dem 1. Januar 2026 wie folgt gefasst:„Das Tätigkeitsmerkmal der herausgehobenen Verantwortung setzt voraus, dass die Arbeitnehmerin aufgrund der Größe und des damit verbundenen Aufgabenbereichs eine deutlich gesteigerte Verantwortung gegenüber der Entgeltgruppe ES 12 wahrnimmt. In der Iuvo gGmbH und dem JugendhilfeNetzwerk Nord-Ost entspricht die Bereichsleitung/Übergeordneter Dienst der Teileinrichtungsleitung mit herausgehobener Verantwortung.“
§ 2
Inkrafttreten
Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.
Hamburg, 16. Dezember 2024 | ||
Für den Verband kirchlicher und diakonischer Dienstgeber in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (VKDN) | Für die Gewerkschaften | |
gez. Unterschriften | gez. Unterschriften | |
Nr. 20Pfarrstellenveränderungen
Pfarrstellenänderungen
Die 1. Pfarrstelle der zum Pfarrsprengel verbundenen Ev.-Luth. Kirchengemeinden Hemme, Lunden, St. Annen und Schlichting, Ev.-Luth. Kirchenkreis Dithmarschen, wird mit Wirkung vom 1. März 2025 mit der 2. Pfarrstelle der zum Pfarrsprengel verbundenen Ev.-Luth. Kirchengemeinden Hemme, Lunden, St. Annen und Schlichting, Ev.-Luth. Kirchenkreis Dithmarschen, zur 1. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinden Hemme, Lunden, St. Annen und Schlichting, Ev.-Luth. Kirchenkreis Dithmarschen, umgewandelt.
Az.: 21 Kkr. Dithmarschen – P Ha
*
Die 3. Pfarrstelle der zum Pfarrsprengel verbundenen Ev.-Luth. Kirchengemeinden Hemme, Lunden, St. Annen und Schlichting, Ev.-Luth. Kirchenkreis Dithmarschen, wird mit Wirkung vom 1. März 2025 in die 2. Pfarrstelle der zum Pfarrsprengel verbundenen Ev.-Luth. Kirchengemeinden Hemme, Lunden, St. Annen und Schlichting, Ev.-Luth. Kirchenkreis Dithmarschen, umgewandelt.
Az.: 21 Kkr. Dithmarschen – P Ha
*
Die 4. Pfarrstelle der zum Pfarrsprengel verbundenen Ev.-Luth. Kirchengemeinden Hemme, Lunden, St. Annen und Schlichting, Ev.-Luth. Kirchenkreis Dithmarschen, wird mit Wirkung vom 1. März 2025 in die 3. Pfarrstelle der zum Pfarrsprengel verbundenen Ev.-Luth. Kirchengemeinden Hemme, Lunden, St. Annen und Schlichting, Ev.-Luth. Kirchenkreis Dithmarschen, umgewandelt.
Az.: 21 Kkr. Dithmarschen – P Ha
*
Der Stellenumfang der Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hemmingstedt, Ev.-Luth. Kirchenkreis Dithmarschen, wird mit Wirkung vom 1. Dezember 2025 von 100 Prozent auf 75 Prozent reduziert.
Az.: 20 Hemmingstedt – P Ha
*
Der Stellenumfang der 4. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Meldorf, Ev.-Luth. Kirchenkreis Dithmarschen, wird mit Wirkung vom 1. März 2025 von 100 Prozent auf 50 Prozent reduziert.
Az.: 20 Meldorf (4) – P Ha
Pfarrstellenerrichtungen
Die Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Pokrent-Groß Brütz, Ev.-Luth. Kirchenkreis Mecklenburg, wird mit Wirkung vom 1. Februar 2025 errichtet.
Az.: 20 Pokrent und Groß Brütz (Pfarrsprengel) – P Ha
Pfarrstellenaufhebungen
Die Verbindung der Pfarrstellen der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Pokrent, Ev.-Luth. Kirchenkreis Mecklenburg, und der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Groß Brütz, Ev.-Luth. Kirchenkreis Mecklenburg, zum Pfarrsprengel wird mit Wirkung vom 1. Februar 2025 aufgehoben.
Az.: 20 Pokrent und Groß Brütz (Pfarrsprengel) – P Ha
Aus den Kirchenkreisen
Nr. 21Bekanntgabe der Auslegung des Haushalts 2025
des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein
des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein
Vom 6. Februar 2025
Der Haushalt des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein für das Jahr 2025 wurde in der Sitzung der Kirchenkreissynode am 16. November 2024 beschlossen.
Gemäß Artikel 125 Absatz 2 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland in Verbindung mit § 8 Absatz 4 des Haushaltsführungsgesetzes vom 28. November 2013 (KABl. S. 474), geändert durch Artikel 2 des Kirchengesetzes vom 18. April 2024 (KABl. A Nr. 34 S. 120), ist der beschlossene Haushalt zu veröffentlichen. Verfügbar ist der kirchenkreisliche Haushaltsplan auf der Homepage des Kirchenkreises Altholstein unter www.kirchenkreis-altholstein.de.
Kiel, 6. Februar 2025 | ||||
Kirchenkreis Altholstein Kirchliches Verwaltungszentrum Im Auftrag | ||||
Köpp | ||||
Nr. 22Vierte Satzung zur Änderung der Kirchenkreissatzung
des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Altholstein
des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Altholstein
Vom 20. Dezember 2024
Die Kirchenkreissynode des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Altholstein hat am 16. November 2024 aufgrund von Artikel 45 Absatz 3 Nummer 1 der Verfassung die nachfolgende Satzung zur Änderung der Kirchenkreissatzung des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Altholstein beschlossen:
####§ 1
Änderungen
Die Kirchenkreissatzung des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Altholstein vom 2. Oktober 2014 (KABl. 2015 S. 109), die zuletzt durch Satzung vom 30. April 2024 (KABl. A Nr. 35 S. 124) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
- In § 13 Absatz 1 Nummer 3 wird der Punkt hinter „Dienste und Werke“ durch ein Semikolon ersetzt.
- In § 13 Absatz 1 wird hinter Nummer 3 eine neue Nummer 4 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:„4. ein Konvent der Gemeindesekretärinnen und Gemeindesekretäre gebildet.“
§ 2
Inkrafttreten
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland in Kraft.
*
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt. Die Satzung ist im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen-Lutherischen Kirche in Norddeutschland bekannt zu machen.
Kiel, 20. Dezember 2024 | ||||
Pröpstin Almut Witt | Ulrich Thomas | |||
(L. S.) | ||||
Vorsitzendes Mitglied des Kirchenkreisrats | Mitglied des Kirchenkreisrats | |||
* | ||||
Die vorstehende Satzung wird hiermit nach Artikel 45 Absatz 5 der Verfassung veröffentlicht.
Kiel, 17. Januar 2025 | ||||
Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Altholstein Kirchliches Verwaltungszentrum Im Auftrag | ||||
Andreas Köpp | ||||
Nr. 23Sechste Satzung zur Änderung der Kirchenkreissatzung des
Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
Vom 28. Januar 2025
Die Kirchenkreissynode des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises hat am 9. November 2024 aufgrund von Artikel 45 Absatz 3 Nummer 1 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, die zuletzt durch Kirchengesetz vom 31. März 2023 (KABl. A Nr. 28 S. 71) geändert worden ist, die nachfolgende sechste Satzung zur Änderung der Kirchenkreissatzung beschlossen:
##Artikel 1
Änderung der Kirchenkreissatzung des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises
Die Anlage 2 zu § 3 Absatz 2 Satz 3 zur Kirchenkreissatzung des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises vom 22. März 2013 (KABl. S. 191), zuletzt geändert durch Vierte Änderungssatzung vom 8. November 2022 wird wie folgt gefasst:
„Anlage 2
Die Kirchengemeinden des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises
1. Propstei Stralsund – bestehend aus den nachfolgenden 52 Kirchengemeinden
Ev. Kirchengemeinde Abtshagen-Elmenhorst
Ev. Kirchengemeinde Ahrenshagen
Ev. Kirchengemeinde Altefähr
Ev. Kirchengemeinde St. Marien Barth
Ev. Kirchengemeinde Bergen auf Rügen
Ev. Kirchengemeinde Binz
Ev. Kirchengemeinde Bodstedt-Flemendorf-Kenz
Ev. Kirchengemeinde Brandshagen
Ev. Kirchengemeinde St. Bartholomäus Damgarten-Saal
Ev. Kirchengemeinde Franzburg-Richtenberg
Ev. Kirchengemeinde Garz-Sehlen-Zudar
Ev. Kirchengemeinde Gingst
Ev. Kirchengemeinde Glewitz
Ev. Kirchengemeinde Grimmen
Ev. Kirchengemeinde Groß Bisdorf
Ev. Kirchengemeinde Groß Mohrdorf
Ev. Kirchengemeinde Mönchgut-Sellin
Ev. Kirchengemeinde Horst
Ev. Kirchengemeinde Kasnevitz
Ev. Kirchengemeinde Kirch-Baggendorf
Ev. Kirchengemeinde Kloster
Ev. Kirchengemeinde Lancken-Granitz
Ev. Kirchengemeinde Lüdershagen
Ev. Kirchengemeinde Neuenkirchen-Rappin
Ev. Kirchengemeinde Nord-Rügen
Ev. Kirchengemeinde Patzig
Ev. Kirchengemeinde Poseritz
Ev. Kirchengemeinde Prerow
Ev. Kirchengemeinde Prohn
Ev. Kirchengemeinde Putbus
Ev. Kirchengemeinde Pütte-Niepars
Ev. Kirchengemeinde Rakow
Ev. Kirchengemeinde Rambin
Ev. Kirchengemeinde Reinberg
Ev. Kirchengemeinde Reinkenhagen
Ev. Kirchengemeinde Sagard
Ev. Kirchengemeinde Samtens
Ev. Kirchengemeinde Sassnitz
Ev. Kirchengemeinde Schaprode-Trent
Ev. Kirchengemeinde Semlow-Eixen
Ev. Kirchengemeinde Starkow und Velgast
Ev. Kirchengemeinde Steinhagen
Ev. Kirchengemeinde Heilgeist-Voigdehagen Stralsund
Ev. Kirchengemeinde Luther-Auferstehungsgemeinde Stralsund
Ev. Kirchengemeinde St. Marien Stralsund
Ev. Kirchengemeinde St. Nikolai Stralsund
Ev. Kirchengemeinde Tribsees
Ev. Kirchengemeinde Vilmnitz
Ev. Kirchengemeinde Vorland
Ev. Kirchengemeinde Waase
Ev. Kirchengemeinde Wiek
Ev. Kirchengemeinde Zingst
2. Propstei Demmin – bestehend aus den nachfolgenden 43 Kirchengemeinden
Ev. Kirchengemeinde Altenhagen-Gültz
Ev. Kirchengemeinde St. Petri Altentreptow
Ev. Kirchengemeinde Bauer
Ev. Kirchengemeinde Beggerow
Ev. Kirchengemeinde Daberkow
Ev. Kirchengemeinde Demmin
Ev. Kirchengemeinde Dersekow-Levenhagen
Ev. Kirchengemeinde Görmin
Ev. Christus-Kirchengemeinde Greifswald
Ev. Johannes-Kirchengemeinde Greifswald
Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald
Ev. Kirchengemeinde St. Marien Greifswald
Ev. Kirchengemeinde St. Nikolai Greifswald
Ev. Bugenhagengemeinde Greifswald Wieck-Eldena
Ev. Kirchengemeinde Gristow-Neuenkirchen
Ev. Kirchengemeinde Groß Bünzow
Ev. Kirchengemeinde Groß Kiesow
Ev. Kirchengemeinde Groß Teetzleben
Ev. Kirchengemeinde Gülzowshof
Ev. Kirchengemeinde St. Nicolai Gützkow
Ev. Kirchengemeinde Hohenbollentin-Lindenberg
Ev. Kirchengemeinde Hohendorf
Ev. Kirchengemeinde Hohenmocker
Ev. Kirchengemeinde Jarmen-Tutow
Ev. Kirchengemeinde Kartlow-Völschow
Ev. Kirchengemeinde Katzow
Ev. Kirchengemeinde Kemnitz-Hanshagen
Ev. Kirchengemeinde Klatzow
Ev. Kirchengemeinde Kröslin
Ev. Kirchengemeinde Lassan St. Johannis
Ev. Kirchengemeinde St. Marien Loitz
Ev. Kirchengemeinde Lubmin-Wusterhusen
Ev. Kirchengemeinde Neu Boltenhagen
Ev. Kirchengemeinde Pinnow-Murchin
Ev. Kirchengemeinde Schlatkow
Ev. Kirchengemeinde Siedenbollentin
Ev. Kirchengemeinde Sophienhof
Ev. Kirchengemeinde Verchen-Kummerow
Ev. Kirchengemeinde Weitenhagen
Ev. Kirchengemeinde St. Petri Wolgast
Ev. Kirchengemeinde Wotenick-Nossendorf
Ev. Kirchengemeinde Ziethen
Ev. Kirchengemeinde Züssow-Zarnekow-Ranzin
3. Propstei Pasewalk – bestehend aus den nachfolgenden 42 Kirchengemeinden, davon 5 (kursiv und im Fettdruck gekennzeichnet) im Bundesland Brandenburg
Ev. Kirchengemeinde Ahlbeck
Ev. Kirchengemeinde Ahlbeck * (* auf der Insel Usedom)
Ev. Kirchengemeinde Altwigshagen
Ev. Kirchengemeinde Anklam
Ev. Kirchengemeinde Benz
Ev. Kirchengemeinde Blumberg
Ev. Kirchengemeinde Blumenhagen
Ev. Kirchengemeinde Boldekow-Wusseken
Ev. Kirchengemeinde Boock
Ev. Kirchengemeinde Brüssow
Ev. Kirchengemeinde Dargitz-Stolzenburg
Ev. Kirchengemeinde Ducherow
Ev. Kirchengemeinde Fahrenwalde
Ev. Kirchengemeinde Ferdinandshof
Ev. Kirchengemeinde Gartz/Oder
Ev. Kirchengemeinde Heringsdorf-Bansin
Ev. Kirchengemeinde Hetzdorf
Ev. Kirchengemeinde Hohenselchow-Hohenreinkendorf
Ev. Kirchengemeinde Jatznick
Ev. Kirchengemeinde Koserow
EV. Kirchengemeinde Krackow-Nadrensee
Ev. Friedenskirchengemeinde Krien
Ev. Kirchengemeinde Krummin-Karlshagen-Zinnowitz
Ev. Kirchengemeinde Leopoldshagen
Ev. Kirchengemeinde Liepen-Medow-Stolpe
Ev. Kirchengemeinde Löcknitz
Ev. Kirchengemeinde Mönkebude
Ev. Kirchengemeinde Morgenitz
Ev. Kirchengemeinde Pasewalk
Ev. Kirchengemeinde Penkun
Ev. Kirchengemeinde Retzin
Ev. Kirchengemeinde Rollwitz
Ev. Kirchengemeinde Rothemühl
Ev. Kirchengemeinde Sommersdorf
Ev. Kirchengemeinde Spantekow
Ev. Kirchengemeinde Strasburg
Ev. Kirchengemeinde Teterin-Lüskow
Ev. Kirchengemeinde Torgelow
Ev. Kirchengemeinde Ueckermünde-Liepgarten
Ev. Kirchengemeinde Usedom
Ev. Kirchengemeinde Zerrenthin
Ev. Kirchengemeinde Zirchow“
#Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland in Kraft.
*
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt.
Greifswald, 28. Januar 2025 | ||||
Pröpstin Kathrin Kühl | Propst Dr. Tobias Sarx | |||
(L. S.) | ||||
Vorsitzende des Kirchenkreisrats | Mitglied des Kirchenkreisrats | |||
* | ||||
Die vorstehende Satzung wird hiermit nach Artikel 45 Absatz 5 der Verfassung veröffentlicht.
Greifswald, 28. Januar 2025 | ||||
Pommersches Evangelisches Kirchenkreisamt Pommerscher Evangelischer Kirchenkreis Im Auftrag | ||||
Fröhlich | ||||
Az.: M 107.1 6/2025 | ||||
Impressum
Herausgeberin und Verlag: | ||
Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Postfach 3449, 24033 Kiel; Dänische Str. 21–35, 24103 Kiel | ||
Redaktion: Runa Rosenstiel (verantwortliche Redakteurin), Tel.: 0431 9797 864, Annette Thiede, Tel.: 0431 9797 872, Nicole Aaldering, Tel.: 0431 9797 840. | ||
Fax: 0431 9797 869, E-Mail: kabl@lka.nordkirche.de | ||
Das Kirchliche Amtsblatt erscheint in der Regel monatlich einmal. | ||
Der Redaktionsschluss für die kommenden Ausgaben Teil A ist jeweils: | Erscheinungsdatum | |
für die 3. Ausgabe 2025: | Do, 13. März | 31. März 2025, |
für die 4. Ausgabe 2025: | Fr, 11. April | 30. April 2025, |
für die 5. Ausgabe 2025: | Fr, 16. Mai | 31. Mai 2025. |
ACHTUNG: Wir bitten die externen Textlieferanten aus den Kirchenkreisen etc. um Beachtung der Bearbeitungszeiten im Landeskirchenamt; hierfür müssen die Texte jeweils etwa eine Woche vor den genannten Schlussterminen bei der zuständigen sachbearbeitenden Stelle vorliegen. In Fällen, in denen Ehrenamtliche mit ihren privaten Kontaktdaten genannt werden, ist es nötig, sich eine Einwilligung bestätigen zu lassen. Ein Muster dafür finden Sie auf www.datenschutz-nordkirche.de. | ||
Das Fachinformationssystem Kirchenrecht bietet unter der Internet-Adresse www.kirchenrecht-nordkirche.de die Möglichkeit zur Online-Recherche in früheren Jahrgängen des Kirchlichen Amtsblattes – auch der Vorgängerkirchen – ab 1919 bis heute. Der Zugang ist kostenlos. Aus dem Fachinformationssystem Kirchenrecht können Ausgaben heruntergeladen und ausgedruckt werden. | ||